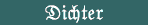Der Arzt
(15. Fortsetzung)
"Mehrere Jahre schwärmte ich in allen Fächern der Wissenschaft umher und wählte endlich, theils nach dem Wunsche meines Vaters, welcher mir jedoch völlig freien Willen in der Wahl des künftigen Berufes ließ, theils aus eigener Lust die Medicin als Brodstudium. Ich hatte von jeher große Vorliebe zur Arznei- und Pflanzenkunde, und es schien mir ein hoher, edler Lebenszweck, der leidenden Menschheit hilfreich zu werden; und dann wären mir auch bei jedem anderen Studium später hohe Gönner und Freunde nöthig gewesen, die ich nicht hatte, um mir ein ausreichendes Amt zu verschaffen, welches ich bei dem immerhin kleinen Vermögen, das auf meinen Theil kam, haben mußte, um mir eine anständige Existenz zu begründen. - So legte ich mich denn mit aller Energie und jugendlich unverdrossenem Eifer auf dieses schöne weitumfassende Studium und hatte auch das Glück, unter einer guten Leitung ziemliche Fortschritte zu machen. Ich hatte ein freies, unabhängiges Leben und konnte mit dem vierteljährigen Geld, womit ich pünktlich versorgt wurde, hübsch auskommen, und bei nicht zu großem Aufwand ganz sorgenfrei den Wissenschaften obliegen. - Meinem Vater ward es indessen nicht so gut; nach und nach trafen ihn harte Schicksalsschläge in dem Tod meiner drei übrigen Geschwister und entrissen ihm seine schönsten Freuden.
"Die Universitätsjahre waren zu Ende und ich verließ nach glücklich überstandenem Examen die Lehrsäle Göttingens, um in die Arme meines guten, einsamen Vaters zu eilen. Mit jugendlichem Vertrauen hegte ich die Hoffnung, bald in meiner Vaterstadt als ordentlicher Arzt praktiziren zu können, und malte auf der Heimreise meine Zukunft mit den lachendsten Bildern, aber es waren und blieben auch nur Bilder!
"Wie fand ich alles sehr verändert, als ich in das Vaterhaus eintrat! Da war nicht mehr das regsame lustige Hämmern und Sägen, das Pfeifen und Singen der munteren Gesellen zu hören; da war nicht mehr Hof und Schoppen angefüllt von schön ausgetrocknetem Holz, was des Schreiners Stolz ist; alles war verschwunden, alles sah kahl, leer und ärmlich aus! Allein fand ich meinen Vater an der Hobelbank stehen und schaffen, daß ihm der Schweiß über die Stirne rann. Das war wohl hart für den alten Mann, der früher seine Zeit nur darauf verwendete, den Arbeitern nachzusehen, Holz zu kaufen und dergleichen. - Ich konnte mir anfangs gar nicht denken, wie es auf die natürlichste Art, ohne das geringste Selbstverschulden zugegangen war. In unserer Stadt nämlich waren nach und nach mehrere Möbelfabriken, von reichen Schreinern und Spekulanten begründet, entstanden und hatten den Ruin der mittleren und kleinen Meister herbeigeführt. Dadurch, daß sie großartige Magazine mit fertigen Arbeiten hielten und durch bedeutende Mittel die Arbeiten nach dem neuesten Geschmack und mit den besten Gesellen, die ihnen zuströmten, fertigen konnten, und überhaupt das große, in Arbeiten unerfahrene Publikum ein gewisses unverzeihliches Vorurtheil zu Gunsten der Fabriken, für alles, was aus denselben kommt, hat, hatten die mit wenigen Geldmitteln oder geringerem Unternehmungsgeist ausgestatteten Meister, unter welchen letzteren auch mein Vater war, nach und nach alle Kunden verloren.
"Entschuldigen sie einmal, lieber Lindloff!" sagte Herr Hübner einfallend. "Hier muß ich doch um eine kleine Erläuterung bitten. Sie sagen, die Fabriken hätten den Ruin der Meister, also eines großen Theil des Volkes, herbeigeführt. Demnach wären ja die Fabriken gerade das Entgegengesetzte von dem, für was sie überall und besonders in den höheren und gelehrten Kreisen gehalten werden, nämlich ein Segen und Aufblühen des Gewerbstandes? Sind nicht in allen statistischen Büchern und vielen Abhandlungen, die über die sozialen Verhältnisse, über den Gewerbestand von, wie man glauben sollte, sachkundigen Männern geschrieben, sind nicht da die Fabrikstädte doppelt hervorgehoben? Hört man nicht überall das Land, welches viele Fabriken zählt, als ein glückliches preisen? Und können wohl so unendlich Viele, welche das Entstehen von Fabriken in einem Land ein segensreiches nennen, können diese so lange im Irrthum bleiben, wenn die Fabriken den Wohlstand der Mittelklassen untergraben?
"Ihre Fragen sind ganz wohl begründet, Herr Hübner, und ich will sie nach meiner Erfahrung beantworten. Es ist nicht zu verkennen, welchen Nutzen die Fabriken einer Stadt, einem Lande, vermöge ihrer Consumtion der Arbeiten nach auswärts, bringen, da hierdurch bedeutende Summen Geldes eingebracht werden, welche den Reichthum vermehren. Aber dieses Geld wandert in die einzelnen Hände der Fabrikanten und bereichert eben nur diese, ohne unter dem ganzen Volke wohlthätig zu zirkuliren, wodurch es doch einzig und allein dem ganzen Volke Nutzen schaffen könnte. Hinsichtlich der Meister nehmen sie dies Exempel: Zehn Meister, wovon jeder fünf Gesellen beschäftigt, ernähren sich und ihre Familien anständig von den Prozenten, welche ihnen die Arbeiten der Gesellen einbringen. Nun kommt ein Fabrikant und gewinnt die Gesellen der gesammten Meister, also auch ihre Kundschaft, für sich und bezieht allein den Gewinn, wovon diese Leute sich ernährt hätten! Was bleibt diesen übrig, wenn sie seine Kunden mehr haben? Höchstens mit ihren zwei Händen ebenfalls in die Fabrik zu arbeiten, um sich ein spärliches Brod zu verdienen.
"So ungefähr steht es mit den Fabriken, nur daß sie nicht so schnell wie in diesem Exempel, sondern in langsamer Reihenfolge aufblühen. Dazu kömmt noch, daß der Arbeiter, dem die Aussicht abgeschnitten ist, jemals sein eigenes Geschäft gründen zu können, lebenslänglich von den Fabriken abhängig ist und nie selbstständig werden kann. Diese Leute, welche die Bücher hierüber geschrieben, haben meistens den Arbeiter vom Mittelstand als ein zu unbedeutendes Individuum betrachtet, und wähnten, es sei wohl eins: ob der Arbeiter oder der Fabrikant den Nutzen habe, wenn sich nur der Reichthum des Landes vermehre, nicht bedenkend, daß der Mittelstand die Grundfeste eines Staates und die wohlthätige Verbindungsmauer zwischen arm und reich ist.
In: Mainzer Anzeiger Nr. 113 vom 16. Mai 1855, S. 448-449