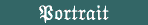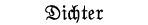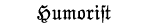Joseph Boudin, Lehrer und Freund

Joseph Boudin (1812-1873)
Joseph Napoléon Boudin wurde am 9. Mai 1812 in Mainz geboren, Sohn des französischen Garde-Kapitäns Markus Boudin aus Lothringen, der sich im napoleonischen Mainz zum Ruhestand niedergelassen hatte.
1830 trat Joseph Boudin als Vikar in den Schuldienst ein und leitete eine Elementarklasse, 1836 erhielt er ein Lehramt für die ersten Klassen an Kommunalschulen in den Mainzer Bezirken A und B (i.e. das Gebiet zwischen Zitadelle und Dom bis ans Rheinufer).
Joseph Boudin war ein Vorreiter des modernen Bildungswesens, in allen Aspekten. Besonders geprägt hatten ihn sein Geographielehrer, der berühmte Dr. Th. Schacht – der ihn auch zum Lehrerberuf hinführte – sowie der Lehrer Weihrauch, der stark von Pestalozzi beeinflusst war. Boudin gestaltete seinen Unterricht lebendig, stützte sich auf Anschauung, und führte die Schüler in ungezwungener Gesprächsatmosphäre vom Bekannten zum Unbekannten, vom Elementaren zum Komplexen, vom Konkreten zum Abstrakten. Er verstand es wie kaum ein anderer, die Gedanken seiner Schüler durch gezielte Fragen in logische Bahnen zu lenken. Das Interesse der Schüler an neuen Themen weckte er durch Erzählung thematisch passender Begebenheiten, meist eigener Erlebnisse. Die Schüler sollten eine möglichst umfassende Allgemeinbildung erlangen und zum vorurteilsfreien, selbsttätigen Denken gebracht werden. Boudins Schüler besuchten die Schule mit Freude und zeichneten sich auch nach dem Ende ihrer Schulzeit durch Wissensdurst und das stetige Verlangen nach Fortbildung aus.
In seiner freien Zeit arbeitete Joseph Boudin Lehrgänge aus und fertigte Unterrichtsmaterial zur Veranschaulichung an. Lange Zeit setzte er sich dafür ein, an den Volksschulen Unterricht in Geometrie und Zeichnen einzuführen.
Eines seiner Hauptanliegen war die Förderung von Gemeinsinn und Vaterlandsliebe unter seinen Schülern – über die Grenzen der Konfessionen hinweg. Die bedeutendsten religiösen Gemeinschaften in Mainz waren zu jener Zeit die römisch-katholische und die evangelische Kirche sowie Deutschkatholiken und Juden. Unter der französischen Besatzung zwischen 1797 und 1814 waren in Mainz Bezirksschulen entstanden, die von allen Kindern eines Bezirks besucht wurden, ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit.
Mitte 1837 ließ der Lehrer Boudin sich für zwei Jahre beurlauben, um sich in Physik und Chemie weiterzubilden. Er studierte in dieser Zeit zunächst an der polytechnischen Schule in Darmstadt, später an der Universität von Paris, wo er von Mainz aus zu Fuß hingewandert ist. Als er 1839 wieder nach Mainz zurückkam, hatten die Verhältnisse an den Schulen sich geändert: Auf Betreiben der Geistlichkeit waren die Bezirksschulen der Franzosen zu Pfarrschulen umgewandelt worden, und Joseph Boudin fand sich als Lehrer an der Domschule wieder. Später wurde er an die Volksschule der Pfarrei St. Ignaz in der Zuchthausstraße versetzt. In den folgenden Jahren wehrte er sich immer wieder dagegen, an einer Pfarrschule tätig zu sein, da er einen Vertrag als Lehrer an Kommunalschulen, nicht jedoch an kirchlichen Schulen hatte. Zwar betrachtete Boudin wahre Religiosität als Basis und Ziel jeglicher Erziehung, er wandte sich jedoch gegen die Umwandlung der Volksschulen zu Kirchenschulen. Boudin war Verfechter der Kommunalschule, in der wie zuvor die Schüler nicht nach Konfessionen getrennt sein sollten, sondern die innerhalb eines Stadtteils von Kindern aller Konfessionen gemeinsam besucht werden sollten.
Im November 1839 gründete Boudin zusammen mit acht anderen Mainzer Bürgern den Lokalgewerbeverein, der großes Interesse unter den Gewerbetreibenden der Stadt hervorrief, und der nach einem Jahr bereits 70 Mitglieder zählte. 1840 gründete der Lokalgewerbeverein eine Handwerkerschule unter der Leitung Boudins, in der Handwerker mit tiefergehenden Fähigkeiten in den Bereichen Geometrisches Zeichnen, Mathematik und Briefschreiben ausgebildet wurden. Im Jahr 1841 besuchten bereits 120 Lehrlinge und Gesellen diese Handwerksschule. Boudins Schüler waren in der Lage, Aufgabestellungen zu lösen, mit denen ihre Meister oft überfordert waren.
Der Mainzer Stadtrat war im Jahre 1848 bereits auf dem halben Wege, die Kommunalschule wiedereinzuführen, wurde jedoch durch die Märzrevolution des gleichen Jahres darin unterbrochen. Nach dem Scheitern der Revolution gewannen ultramontane, konservativ-katholische Kreise an Einfluss auf die Regierung des Großherzogtums Hessen-Darmstadt, und unter dem reaktionären Ministerpräsidenten Dalwigk verwarf man fortan alle Anträge der Mainzer bezüglich der Einführung von Kommunalschulen.
Auch angesichts des starken kirchlichen Einflusses auf die
Politik stand Joseph Boudin weiterhin zu seiner Überzeugung – und zog damit
den Unwillen der Kirche auf sich. Doch in Mainz stand man zu dem beliebten
Lehrer. Einmal besuchte ein Realschuldirektor aus Alzey die Handwerkerschule
des Mainzer Lokalgewerbevereins und beschwerte sich sogleich bei der Schulkommission
der Stadt über Boudin, der einen "gefährlichen Einfluss" auf die
jungen Handwerker ausübe. Die Mainzer Schulkommission reagierte hierauf
mit einem Brief an Boudin, in dem sie ihm ihre vollkommenste Zufriedenheit
über seine Tätigkeit ausdrückte und ihn dazu aufforderte, wie bisher fortzufahren
und sich nicht beirren zu lassen.
Es folgten Unterstellungen durch den
damaligen Mainzer Bischof, Boudin habe vor seinen Schülern ketzerische Taten
begangen. eine davon sei, dass er in der Volksschule das Bild eines Priesters
mit geschwärztem Gesicht an die Wand gehängt habe, um es durch seine Schüler
verspotten zu lassen. Eine Untersuchungskommission klärte den Sachverhalt
auf: Boudin hatte im Rahmen des anthropologischen Unterrichts das Bild eines
schwarzafrikanischen katholischen Missionars an die Wand gehängt, das aus
Blumenbachs Naturgeschichte stammte, und die Schüler waren sichtlich
erstaunt, als sie über die angebliche Verhöhnung des Bildes befragt wurden.
Auch
weitere Angriffe der Kirche auf Boudin verfehlten in ähnlicher Weise ihr
Ziel.
Der Mainzer Gewerbeverein begrüßte Boudins Lehrmethoden und sah sie als sehr geeignet an, die jungen Menschen auf die soeben beginnende Industrialisierung vorzubereiten. Gegen den Widerstand der Kirche gelang dem Gewerbeverein nach zwei Jahren die Gründung einer Gewerblichen Fortbildungsschule in Mainz. Auch gelang es, Joseph Boudin von der Pfarrschule St. Ignaz beurlauben zu lassen. Die Gewerbliche Fortbildungsschule wurde am 6. Juni 1853 eröffnet. Bereits nach drei Wochen folgte die erste Reaktion der Bezirks-Schulkommission in Darmstadt: Diejenigen Knaben an der Schule, "die nicht das heilige Abendmahl empfangen haben", seien sofort zu entlassen. Lange wehrten sich Eltern, Lehrer und der Gewerbeverein gegen diesen Erlass. eine Untersuchungskommission besuchte die Schule zwecks Prüfung – und war begeistert von Leistungen und Benehmen der Schüler. 1855 schließlich erfolgte die gewaltsame Auflösung der Gewerblichen Fortbildungsschule, indem das Ministerium die tragende Kraft dieser Schule, Joseph Boudin, an die Realschule versetzte.
Die Realschule verließ Boudin nach kurzer Zeit, in erster Linie durch Krankheit bedingt. Dieser Zeitpunkt markiert das Ende seines Lehramtes. Nach seiner Genesung schlug er Angebote für einträgliche Posten aus und lehrte stundenweise an einer Privatschule. Unnötig zu erwähnen, dass diese Privatschule binnen Kurzem einen gewaltigen Schülerandrang verzeichnete.
Im Rahmen seines Anschauungsunterrichts erstellte Joseph Boudin bildliche Darstellungen der technischen Errungenschaften seiner Zeit wie Dampfmaschine, Telegraf oder Gaszähler sowie tatsächlich funktionierende Modelle dieser Gerätschaften. Sein Modellkabinett entwickelte einen großen Platzbedarf und konnte im kurfürstlichen Schloss untergebracht werden. Ein Planetarium wurde nach seinen Vorgaben gebaut, anhand dessen er das Planetensystem, Jahres- und Tageszeiten, Ebbe und Flut etc. erklärte. Nach vielen Experimenten entwickelte Joseph Boudin 1859 zuverlässige elektrische Uhren, die dann in der Stadt Mainz aufgestellt wurden; viele andere Städte versuchten sich damals erfolglos an der Einführung elektrischer Uhren.
Im Jahre 1860 ernannte die Stadt Mainz ihren ehemaligen Lehrer Boudin zum Kontrolleur der städtischen Gasanstalt, und übertrug ihm auch die Aufsicht über die elektrischen Uhren sowie über das physikalische und das Modellkabinett.
1861 wurde er in den Gemeinderat gewählt, wo er neun Jahre lang der Schulkommission angehören sollte. Hier konnte Boudin einige seiner Ziele in der Modernisierung des Schulwesens verwirklichen; u.a. bewerkstelligte er die neue Einteilung der Schulklassen nach Alter und Fähigkeiten der Schüler sowie die differenziertere Verteilung des Lehrstoffes auf nunmehr sechs Jahrgänge. Vordem hatte es nämlich nur zwei Klassen gegeben: die Unterklasse für die sechs- bis zehnjährigen und die Oberklasse für die elf- bis vierzehnjährigen Schüler.
Am 20. Februar 1873 verstarb Joseph Boudin an einem Herzleiden. Drei Wochen nach seinem Ableben erschien ein Aufruf von ehemaligen Schülern, in dem die Öffentlichkeit zu Spenden für ein Denkmal zu Ehren des Lehrers sowie eine zu gründende Boudin-Stiftung aufgefordert wurde. Unterzeichnet war dieser Spendenaufruf von einflussreichen und angesehenen Bürgern der Stadt, darunter auch der Mainzer Oberbürgermeister Carl Wallau (1823-1877) als Vorsitzendem. Das Denkmal wurde am 31. Oktober 1875 eingeweiht und stand auf der Grabstätte Boudins auf dem Mainzer Friedhof. Boudins Büste auf dem Denkmal wurde von dem Bildhauer Scholl modelliert und nach modernsten Fertigungsmethoden in einer galvanoplastischen Fabrik hergestellt.
Eines von Boudins Hauptanliegen wurde drei Jahre nach seinem Tod verwirklicht, als 1876 die Mainzer Pfarrschulen wieder in Kommunalschulen umgewandelt wurden.
Theodor Eichberger besuchte Ende der 1840er Jahre bei Boudin die Oberklasse der Pfarrschule St. Ignaz. Folgende Dokumente aus Th. Eichbergers Textsammlung mögen das Bild des ehemals in weiten Kreisen hochgeschätzten und heute vergessenen Mainzer Lehrers Joseph Boudin ergänzen:
Ein Bericht über die Enthüllung des Boudin-Denkmals in der Mainzer Zeitung vom November 1875.
Der Epilog zur Enthüllung des Boudin-Denkmals sowie eine Reihe von Gedichten und Liedern aus der Feder Theodor Eichbergers zu Ehren des beliebten Schulmannes: